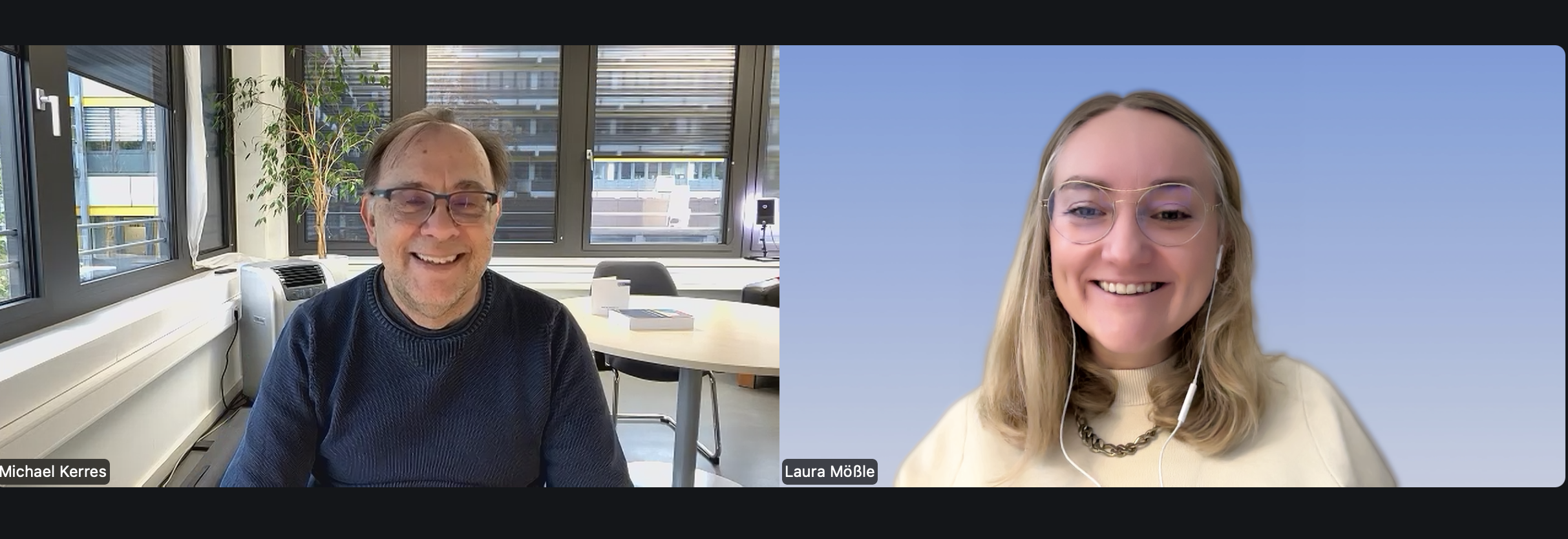Am 8. Oktober 2025 traf sich Laura vom FOERBICO-Team zu einem anregenden Austausch mit Prof. Dr. Michael Kerres vom Learning Lab von der Universität Duisburg-Essen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen grundlegende Fragen zur digitalen Transformation im Bildungsbereich. Besondere Aufmerksamkeit galt der Rolle von OEP, den Anforderungen an tragfähige digitale Infrastrukturen sowie dem Potenzial offener Bildung zur Förderung informeller Lernprozesse, wie etwa im Ehrenamt.
Bildungsräume im Wandel: Einblicke in das Learning Lab
Das Learning Lab der Universität Duisburg-Essen kooperiert mit einer Vielzahl von Bildungseinrichtungen und -trägern mit einem besonderen Fokus auf die Erwachsenen- und Weiterbildung, berufliche Qualifizierung, außerschulische Bildungsangebote und lebenslanges Lernen. Im Zentrum stehen dabei zentrale Fragen wie: Wie gelingt digitale Transformation im Bildungswesen? Welche Infrastrukturen sind erforderlich, damit offene Bildungsprozesse nachhaltig wirksam werden können? Und wer sind die entscheidenden Akteure, um solche Prozesse zu gestalten?
Ein Punkt, den Prof. Kerres exemplarisch aufgezeigt hat, betrifft die Ausstattung von Schulen. Zwar verfügen viele Schulen inzwischen über Tablets im Klassensatz, doch fehlen häufig passende digitale Schulbücher, tragfähige Server-Infrastrukturen und nicht zuletzt Fortbildungen für Lehrkräfte. Diese Defizite werfen die Frage auf: Wer trägt die Verantwortung für den Aufbau digitaler Infrastrukturen? Sind es die Schulträger, Landesinstitute oder andere Instanzen? Im Gespräch wurde deutlich, dass die gegenwärtige Fragmentierung eine systematische digitale Transformation erheblich erschwert.
OEP als Infrastruktur- und Kulturfrage
In Anlehnung an die OER-Strategie des Bundes (2022) wurde in unserem Gespräch auch deutlich, dass OEP weit mehr als die bloße Bereitstellung freier Bildungsmaterialien darstellen. Sie verweisen auf eine umfassendere Bildungsvision, nämlich auf offene, partizipative Lernkulturen, die durch interoperable Infrastrukturen, Qualitätskriterien und kollaborative Praktiken getragen werden.
Prof. Kerres betonte in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, die infrastrukturelle Fragmentierung im Bildungsbereich kritisch zu hinterfragen. Ist es zukunftsfähig, wenn Bildungsinhalte verstreut über Plattformen von Unternehmen, Trägern oder Kirchen angeboten werden, jeweils mit eigenen technischen und pädagogisch-didaktischen Standards? Oder braucht es nicht vielmehr eine öffentlich verantwortete Infrastruktur, die Zugänglichkeit, Interoperabilität und Qualitätssicherung gewährleistet?
Auch FOERBICO versteht sich als strategische Klammer für offene Bildungsprozesse im religionspädagogischen Feld: Das Verbundprojekt stärkt und vernetzt bestehende OER-Communities of Practice und setzt gezielt auf die Etablierung von Metadatenstandards, um die Interoperabilität über Plattform- und Institutionsgrenzen hinweg zu fördern. In der Schwerpunktsetzung auf religionsbezogene Bildungsakteure zeigt sich jedoch eine fachspezifische Verankerung, die Kooperationen mit anderen Fachkulturen bislang nur punktuell realisiert. Damit steht auch FOERBICO vor der Herausforderung, dass OER-/OEP-Initiativen oft auf ihre jeweiligen Fachkulturen beschränkt bleiben, was den Wissenstransfer und die nachhaltige Wirkung über disziplinäre Grenzen hinweg einschränkt.
Ehrenamt als Bildungsakteur
Prof. Kerres richtete noch den Blick auf eine oft übersehene Bildungsdimension: die Qualifizierung ehrenamtlich Engagierter. Ob in der Geflüchtetenhilfe oder in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind viele Ehrenamtliche gefordert, sich kontinuierlich fortzubilden. Oftmals stehen sie dabei unter einem gewissen Qualifizierungsdruck, dem sie zeitlich kaum gerecht werden können. Deshalb stellte sich das Learning Lab die Frage: Wie lassen sich Bildungsräume gestalten, die jenseits formaler Settings niedrigschwellige Lerngelegenheiten bieten und die Qualifizierung im Ehrenamt auf diese stärken?
Ein Beispiel dafür ist das gemeinsam mit dem Volkshochschulverband entwickelte Ehrenamtsportal. Es zeigt exemplarisch, wie digitale Infrastruktur niedrigschwellige Lernangebote bereitstellen und den Wissenstransfer innerhalb von Communities fördern kann.
Die Chance von Personal Learning Environments
Am Ende des Gesprächs rückte ein Konzept in den Fokus, das vor allem mit Blick auf Lebenslanges Lernen zunehmend an Bedeutung gewinnt: sogenannte Personal Learning Environments (PLEs). Diese individuell gestaltbaren Lernumgebungen ermöglichen es Lernenden, eigene Bildungswege zu entwickeln, die sie über ihre gesamte Lebensspanne hinweg nutzen können. Sie eröffnen Chancen für selbstbestimmtes Lernen und ermöglichen die Verschränkung von formellen und informellen Lernprozessen.
Eine vertiefende Auseinandersetzung mit diesem Ansatz erscheint 2026 in einer gemeinsamen Publikation von Paula Paschke, Florian Mayrhofer und Laura Mößle von der Professur für Religionspädagogik und Mediendidaktik der Goethe-Universität Frankfurt im Sammelband Räume der Hochschullehre. Bildungsorte für die Zukunft, herausgegeben von Mrohs, Lorenz et al. im transcript Verlag.
Das Gespräch mit Prof. Kerres bot einen inspirierenden Impuls, Bildungsräume auch über formale Bildungsinstitutionen hinaus zu denken. Es ermutigte dazu, im Rahmen des FOERBICO-Projekts und darüber hinaus Perspektiven auf gemeinschaftliches Lernen und die Gestaltung offener Bildungsinfrastrukturen weiterzuentwickeln.